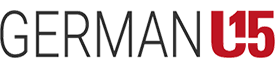U15 Dossier: Ansätze zur Forschungssicherheit weltweit
Einleitung
Weltweit haben forschungsstarke Länder in den vergangenen Jahren nationale Strategien entwickelt, um Wissenschaftseinrichtungen im Umgang mit Sicherheitsrisiken in internationalen Kooperationen zu befähigen. Ausschlaggebend sind dabei maßgeblich Interessen nationaler Sicherheit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Befeuert durch geopolitische Spannungen und technologische Wettbewerbsdynamiken werden Forschungs- und Innovationspolitik so zunehmend im Spiegel von Sicherheit gesehen. Deutschlands enge Partner in der internationalen Forschung bauen ihre Sicherheitsarchitekturen weiter aus und erwarten dies zunehmend auch von ihren Partnern (Stichwort „trusted partner“).
In internationalen Foren und Debatten geht es neben dem Austausch von Informationen und Herangehensweisen zunehmend auch um die Frage von „Harmonisierung“ und Vergleichbarkeit von Ansätzen in der Forschungssicherheit.
Wie aber sind Forschungssicherheitsstrukturen in forschungsstarken Ländern weltweit gestaltet? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten weisen sie auf?
Wir stellen ausgewählte Ansätze vor.
Auf sechs Punkte kommt es besonders an:
1 Forschungssicherheitsstrukturen weltweit: ein Überblick
Die ersten Ansätze zur Implementierung von Forschungssicherheitsstrukturen entstanden in Kanada (ab 2016), Australien (ab 2019) und den USA (ab 2019), innerhalb der EU waren die Niederlande und Frankreich die ersten Länder mit umfassenden Ansätzen zur Forschungssicherheit. Insbesondere das Modell der Niederlande mit ihrer Nationalen Kontaktstelle wird häufig als Vorreiter herangezogen.
Trotz gemeinsamer Zielsetzung – dem Schutz geistigen Eigentums, Schutz vor ungewolltem Wissensabfluss und ausländischer Einflussnahme – unterscheiden sich die Ansätze weltweit teils erheblich in Struktur, Verantwortungsverteilung und regulatorischer Tiefe. Insgesamt spiegeln die unterschiedlichen Ansätze nachvollziehbare nationale Sicherheitskulturen, Governance-Traditionen und Verhältnisbestimmungen zwischen Wissenschaft und Staat wider. Gleichzeitig lässt sich international ein wachsender Trend zur Institutionalisierung und Professionalisierung von Forschungssicherheitsstrukturen feststellen – häufig mit Verweis auf eine vorsichtige Annäherung und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Ansätze (hin zu „trusted partner“).
GemeinsamkeitenDie wichtigste Beobachtung beim Blick auf Ansätze zur Forschungssicherheit weltweit ist, dass es eine zentrale Herausforderung gibt, die allen hier betrachteten Ländern gemein ist: die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen wissenschaftlicher Offenheit und notwendigem Schutz. Debatten darüber werden in allen Ländern, deren Ansatz hier vorgestellt wird, geführt.
Die meisten Ansätze verstehen Forschungssicherheit als Querschnittsaufgabe zwischen Wissenschaft, Politik und Sicherheitsbehörden. Sie setzen auf Kombinationen aus rechtlichen Vorgaben, Sensibilisierungsmaßnahmen und institutionellen Unterstützungsstrukturen. Zentrale Elemente sind:
- Nationale Richtlinien oder Leitlinien (z. B. in den USA, Kanada, Australien, Frankreich, Niederlande),
- Kooperationsformate zwischen Regierung und Wissenschaft (z. B. in Kanada, Australien, Niederlande),
- Zentrale (auf nationaler Ebene) Beratungs- und Informationsstellen (z. B. in UK, USA, Niederlande),
- sowie dezentrale Umsetzung durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Die Unterschiede zeigen sich insbesondere in der steuernden Rolle des Staates und in der Verbindlichkeit der Maßnahmen:
- Regulatorische vs. kooperative Modelle: Während Länder wie das Vereinigte Königreich, Frankreich und die USA starke gesetzliche Rahmensetzungen verankern, setzen Länder wie die Niederlande, Kanada oder Australien stärker auf Kooperation und Selbstregulierung basierende Modelle, bei denen Beratung, Transparenz und gemeinsame Leitlinien im Vordergrund stehen.
- Zentralisierung vs. Dezentralisierung: Frankreich setzt auf zentral koordinierte Strukturen. In Kanada und Australien hingegen agieren wissenschaftsnahe Netzwerke gemeinsam mit der Regierung. Die USA kombinieren zentrale Vorgaben mit föderaler Umsetzung durch Forschungseinrichtungen und Förderagenturen. Die Niederlande haben dezentrale Expertenteams an Hochschulen institutionalisiert. Diese sind in nationale Austauschformate eingebettet.
- Zielgruppen und Fokusbereiche: Die Spannbreite reicht von rein forschungsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Italien, Dänemark) bis hin zu breiteren Konzepten von Knowledge Security, die auch Hochschullehre und Technologietransfer einschließen (z. B. Niederlande, Australien). Die USA und Kanada haben spezifische Maßnahmen für besonders sicherheitsrelevante Technologiebereiche entwickelt – häufig in Abgrenzung zu bestimmten Herkunftsländern.
In Deutschland wurde lange auf die dezentrale Gestaltung von Forschungssicherheitsansätzen gesetzt. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer und Helmholtz haben eigene Ansätze entwickelt bzw. Programme aufgesetzt, Hochschulen implementieren Exportkontrollstellen und zunehmend darüberhinausgehende holistische Ansätze, die Fragen der Forschungsintegrität einschließen. Einrichtungen der Wissenschaftsorganisationen, wie DAAD KIWi, der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von Leopoldina und DFG, der DLR-Projektträger im Auftrag des BMBF und in Zusammenarbeit mit der HRK informieren und beraten zu Chancen und Risiken internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Im September 2024 initiierte darüber hinaus das BMBF einen Stakeholder-Prozess mit Vertreter*innen unterschiedlicher Ministerien, Nachrichtendienste und Wissenschaftsorganisationen (inkl. German U15). Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis der Forschungssicherheitsstrukturen in Deutschland und einer geteilten Verantwortung dafür zu etablieren.
2 Ausgewählte Ansätze im Fokus
Europäische Union
Die Europäische Union verfolgt in ihren Anstrengungen zur Stärkung von Forschungssicherheit insbesondere wirtschaftliche Interessen (nationale Sicherheit liegt demgegenüber in der Hoheit der Mitgliedsstaaten). Grundlage für die Bestrebungen der EU zum Auf- und Ausbau gemeinsamer und in allen Mitgliedsstaaten vergleichbarer Forschungssicherheitsstrukturen bilden insbesondere die folgenden Leitlinien und Strategien der EU:
- Der Globale Ansatz für Forschung und Innovation (2021) und das Toolkit zur Bekämpfung ausländischer Einmischung (2022).
- Mit der Einführung der EU-Strategie für wirtschaftliche Sicherheit im Juni 2023 gewann Forschungssicherheit weitere politische Dynamik.
- Am 24. Januar 2024 legte die EU-Kommission (EU-KOM) einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Forschungssicherheit vor (Council Recommendations on Research Security). Die 27 Forschungsminister*innen nahmen die Empfehlungen auf der Ratssitzung vom 23. Mai 2024 einstimmig an. Hintergrund: EU-Maßnahmen sind erforderlich, da Maßnahmen nur dann wirksam sein können, wenn sie in ganz Europa konsequent angewendet werden.
- Am 28.02.2025 legte die EU-KOM ihren Vorschlag zur ERA-Politikagenda 2025–2027 vor. Forschungssicherheit ist darin eine der vorrangigen Maßnahmen.
Zentral für die Umsetzung vergleichbarer Forschungssicherheitsstrukturen in Europa sind die Council Recommendations. Obwohl die Empfehlungen nicht rechtsverbindlich sind („Soft Law“), sind sie politisch richtungsweisend. Mit ihnen verfügt die EU über einen gemeinsamen Bezugspunkt mit Definitionen, gemeinsamen Grundsätzen und Leitlinien dafür, wie eine wirksame und angemessene Implementierung in den Mitgliedsstaaten aussehen kann. Forschungssicherheitsstrukturen sollen demnach auf einer verbesserten Selbstverwaltung aufbauen: Die Hauptverantwortung liegt bei den Forschenden („mit der akademischen Freiheit geht auch akademische Verantwortung einher“), wobei staatliche Akteure den Wissenschaftssektor durch die Bereitstellung von Informationen, Beratung und Unterstützung in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Council Recommendations richten sich insbesondere an Behörden, Forschungsförderer, Forschungsträger und die EU-KOM selbst. Zu den Maßnahmen, die die EU-KOM derzeit zur Umsetzung der Empfehlungen anstrebt, gehören (Stand März 2025):
- Schaffung eines europäischen Austauschformats für Forschungssicherheit bestehend aus Expert*innen der Mitgliedstaaten, in der EU ansässigen Forschungsförderern und Interessenverbänden,
- Monitoring der Umsetzung der Council Recommendations (erstmals für September 2025 geplant),
- Organisation einer zweijährlichen europäischen Leitkonferenz zum Thema Forschungssicherheit (die erste ist für Oktober 2025 geplant),
- Einrichtung eines Europäischen Kompetenzzentrums für Forschungssicherheit (Analysen für die Politikgestaltung und Schaffung einer Community of Practice; Start: evtl. Mitte 2026).
Unabhängig von diesen stärker die Forschungsintegrität betreffenden Fragen und Vereinheitlichung von Forschungssicherheitsansätzen gelten in der EU strenge Exportkontrollvorgaben und Sanktionslisten (EU Sanctions Map), die auch für den wissenschaftlichen Bereich rechtsverbindlich sind und in den Mitgliedsstaaten jeweils umgesetzt werden.
Frankreich
In Frankreich wird unter Leitung des Generalsekretariats für Verteidigung und nationale Sicherheit (SGDSN) der sog. „Mechanismus zum Schutz des wissenschaftlichen und technischen Potenzials der Nation (dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation = PPST)“ gesteuert. SGDSN ist ein interministerielles Gremium, das von den für Landwirtschaft, Verteidigung, Wirtschaft, Ökologie, Forschung und Gesundheit zuständigen Ministerien eingesetzt wird und das über sechs hochrangige Verteidigungs- und Sicherheitsbeamt*innen zusammenarbeitet. An den meisten französischen Universitäten gibt es eigene Forschungssicherheitsstellen (bzw. Schnittstellen zum SGDSN), an denen Fragen zur Forschungssicherheit geklärt werden. In der Regel sind die Mitarbeitenden auf diesen Stellen Entsandte aus den Ministerien selbst. Im Mechanismus zum Schutz des wissenschaftlichen und technischen Potenzials (PPST) werden u.a. die folgenden Bereiche geregelt:
- Kontrolle des physischen Zugangs zu bestimmten Bereichen, den sogenannten „Zonen mit restriktivem Regime“ (ZRR), durch Einholung einer Stellungnahme des zuständigen Ministeriums;
- Rechtlicher Schutz vor feindlichen Handlungen, die sich auf die Integrität und Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschaftseinrichtung auswirken (betrügerische Verwendung von Informationen, Diebstahl oder Abfangen sensibler Daten, wettbewerbswidrige Praktiken, Eindringen in Informationssysteme usw.);
- Staatliche Unterstützung bei der Erhöhung des Sicherheitsniveaus von Einrichtungen;
- Sensibilisierung von Arbeitsteams;
- Sicherheitsgutachten zu wissenschaftlichen und technischen Kooperationsprojekten mit ausländischen Partnern.
Niederlande
In den Niederlanden wird die Terminologie „Knowledge Security“ genutzt. Sie schließt Hochschulbildung ein und bezieht sich damit nicht ausschließlich auf den Forschungsbereich. Der niederländische Ansatz basiert im Wesentlichen auf Selbstregulierung durch den Wissenschaftssektor, räumt aber gleichzeitig der Regierung als Verantwortliche für den Schutz der nationalen Sicherheit eine zentrale Rolle ein.
Organisationen wie die Universitäten der Niederlande (UNL), die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften (KNAW), der Niederländische Forschungsrat (NWO), die Niederländische Vereinigung der Fachhochschulen (VH), der Niederländische Verband der Universitätskliniken (NFU) und der Verband der angewandten Forschungseinrichtungen (TO2-Verband) agieren als Initiatoren und Vermittler von Knowledge Security, sie kommen in eigenen Arbeitsgruppen zusammen, tauschen sich zu Herausforderungen und Best Practices aus. Sie sind zudem an den zentralen Initiativen der Regierung beteiligt, um den Bereich der Knowledge Security an Wissenschaftseinrichtungen zu implementieren.
Die niederländische Regierung sieht ihre Rolle darin, Informationen zur Verfügung zu stellen, Handlungsoptionen aufzuzeigen und bei Bedarf Rahmenbedingungen festzulegen. Auf Initiative des Wissenschaftsministeriums wurde in Kooperation mit weiteren Ministerien, Sicherheitsdiensten und Fördereinrichtungen die Nationale Kontaktstelle für Knowledge Security eingerichtet. Diese stellt Informationen bereit und berät Wissenschhaftseinrichtungen, die an internationalen Kooperationen beteiligt sind. Einrichtungen können diese Beratung nutzen, um Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Die Nationale Kontaktstelle steht mit relevanten Abteilungen der niederländischen Zentralregierung und Branchenverbänden in Verbindung und bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur Knowledge Security.
Darüber hinaus haben verschiedene Ministerien (u.a. Wissenschaft, Innen, Wirtschaft, Verteidigung, Nachrichtendienste) und Vertreter*innen des Wissenssektors (KNAW, NWO, UNL, VH, NFU und TO2-Föderation) gemeinsame Richtlinien für Knowledge Security erstellt, die Orientierung und Unterstützung zur Implementierung von Forschungssicherheitsstrukturen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen geben sollen.
So bestehen an den meisten Hochschulen Strukturen für das Risikomanagement, die sich an diesen Empfehlungen orientieren. Auf Leitungsebene wird eine Person als Hauptverantwortliche bestimmt. Sie wird von einem Team unterstützt und beraten, das aus mehreren Expert*innen mit unterschiedlichen Fachkenntnissen besteht, z.B. (1) Sicherheitskoordinator*in oder Sicherheitsberater*in; (2) Expert*in auf dem Gebiet der Informationssicherheit (z. B. Chief Information Security Officer/CISO); und (3) Expert*in auf dem Gebiet der Internationalisierung/internationalen Zusammenarbeit. Je nach Fall können weitere Expert*innen hinzugezogen werden (z. B. Personalberater*in).
Dänemark
Das dänische „Komitee für Richtlinien in der internationalen Zusammenarbeit in Forschung und Innovation“ (URIS) wurde 2020 vom Ministerium für Hochschulbildung und Wissenschaft gegründet. Dieses veröffentlichte im Jahr 2022 nationale Richtlinien zur Implementierung von Forschungssicherheit an Wissenschaftseinrichtungen. Die Richtlinien beschreiben Risiken in Bezug auf internationale Forschungszusammenarbeit und adressieren den Umgang mit geistigem Eigentum in internationalen Kooperationen. Auf Basis der Richtlinien implementieren die dänischen Hochschulen Forschungssicherheitsstrukturen in ihren Einrichtungen. Das Wissenschaftsministerium hat zudem eine Arbeitsgruppe mit allen dänischen Universitäten eingerichtet, die die Implementierung der Forschungssicherheitsstrukturen begleitet.
Italien
In Italien wird seit Anfang 2024 ein umfassender Prozess zur Entwicklung von Forschungssicherheitsstrukturen auf Initiative des Wissenschaftsministeriums aufgesetzt. Gesteuert wird dieser durch eine Arbeitsgruppe mit Vertreter*innen des Ministeriums und Mitgliedern von Universitäten und Forschungseinrichtungen. Zunächst wurde eine umfangreiche Bedarfserhebung unter allen Wissenschaftsakteuren vorgenommen, auf deren Ergebnissen nun das Forschungssicherheitssystem aufgebaut werden soll.
Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich (VK) gibt es in Bezug auf Forschungssicherheit vier gesetzliche Grundlagen, mit denen Universitäten konform sein müssen und dafür an ihren Einrichtungen Forschungssicherheitsstrukturen eingeführt haben. Diese vier Grundlagen betreffen Technologies, People, Ownership und Foreign Influence:
1. Exportkontrollrecht zur Kontrolle strategischer Güter und Technologien; angesiedelt beim Dept. of Business and Trade sowie Dept. of International Trade. Genehmigungen werden durch Universitäten über die Export Control Unit eingeholt (entspricht in Deutschland dem BAFA).
2. Academic Technology Approval Scheme (ATAS): angesiedelt im Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). ATAS gilt für bestimmte ausländische Studierende (ab Postgrad) und Forschende, die in Großbritannien in bestimmten sensiblen technologiebezogenen Bereichen studieren oder forschen möchten. Das FCDO verwaltet das Programm und stellt ATAS-Zertifikate für die jeweiligen Personen aus. Beantragt werden die Zertifikate über die Hochschulen.
3. National Security and Investment Act (NSI): angesiedelt im Cabinet Office. Das Gesetz befugt die Regierung, Geschäftstransaktionen wie Übernahmen, Übertragungen von Vermögenswerten, etc. zum Schutz der nationalen Sicherheit zu prüfen und einzugreifen. Hierbei geht es im engeren Sinne also um Eigentums- und IP-Rechte. Das Gesetz wird auf Universitäten und Unternehmen angewendet.
4. Foreign Influence Registration Scheme (FIRS): Verlangt die Registrierung bestimmter Aktivitäten oder Vereinbarungen mit bestimmten Ländern oder von Regierungen kontrollierten Einrichtungen.
Für die Hochschulen wurden darüber hinaus zwei Stellen zur unterstützenden Information und Beratung geschaffen:
- Research Collaboration Advice Team (RCAT): eingerichtet vom Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) im März 2022. Es berät Forschende und Hochschulen zu Risiken in internationalen Kooperationen und unterstützt u.a. mit Risikomanagement-Leitfäden Hochschulen dabei, Forschungssicherheitsstrukturen zu implementieren.
- Die National Protective Security Authority (NPSA) stellt in Kooperation mit dem National Cyber Security Centre umfassende Informationen und Schulungen unter dem Titel „Trusted Research“ zur Verfügung: Trusted Research | NPSA.
USA
In den USA bilden zwei zentrale Rechtsvorschriften die Grundlage für die Implementierung von Forschungssicherheit:
1. das National Security Presidential Memorandum 33 (NSPM-33) von Januar 2021 (Trump I-Administration) und die zugehörige „Guidance for Implementing NSPM-33 von Januar 2022 (Biden-Administration),
2. der CHIPS and Sciences Act (2022).
Das NSPM-33 schreibt Einrichtungen mit mehr als 50 Mio. US$ Drittmitteln die Implementierung von Forschungssicherheitsstrukturen vor. Der CHIPS and Sciences Act richtet sich zu großen Teilen auf die F&E-Stärkung von Halbleitern in den USA gegen die Konkurrenz aus China. Ein zweiter Teil ist dem Ausbau von Quantumcomputing, experimenteller Physik, Raumfahrt, Materialwissenschaften, Biotechnologie – und – Mitteln für Forschungssicherheit gewidmet. Darauf aufbauend haben Forschungsförderer, wie das Department of Defence (DoD), Department of Energy (DoE), National Institutes of Health (NIH) und National Science Foundation (NSF) eigene Prüfverfahren aufgesetzt und in ihre Vergabeverfahren integriert. An Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurden daraufhin Forschungssicherheitsstrukturen implementiert.
Mit den im CHIPS and Sciences Act vorgesehenen Mitteln für Forschungssicherheit wurde die NSF zudem beauftragt das Programm SECURE (Safeguarding the Entire Community in the U.S. Research Ecosystem) aufzubauen und auszuschreiben (Förderdauer: 5 Jahre). Programmstart war der 1. September 2024. Knapp 50 Mio. US$ gingen an ein Konsortium aus zehn Universitäten (SECURE Center) unter Leitung der University of Washington zur Beratung von Forschenden sowie weitere gut 17 Mio. US$ an ein Konsortium aus drei Hochschulen und ThinkTanks, die unterstützende Analysen bereitstellen (SECURE Analytics). Ziel ist es, die Forschungscommunity zu befähigen, kritische Entscheidungen über Sicherheitsbedenken in der Forschung zu treffen. Dafür werden Informationen und Beratungsdienstleistungen bereitgestellt und Tools zur Due Diligence-Prüfung entwickelt. Zielgruppen sind Hochschulen, gemeinnützige Forschungseinrichtungen und kleine und mittlere Unternehmen.
Kanada
Kanada verfolgt einen Mehrebenenansatz, der Forschungssicherheit als kollektive Aufgabe von Forschenden, Forschungseinrichtungen, Förderorganisationen und Regierungen versteht. 2018 gründeten die kanadische Zentralregierung, Forschungsfördereinrichtungen und Universitätsvertreter*innen (darunter U15 Canada) gemeinsam die Governement of Canada – Universities Working Group, die das Thema bis heute regelmäßig diskutiert und weiterentwickelt. Diese Gruppe entwickelte u.a. gemeinsame Richtlinien zur Forschungssicherheit, die nun eine der drei zentralen Elemente der kanadischen Sicherheitsarchitektur bilden:
1. Nationale Richtlinien: Die Government of Canada – Universities Working Group entwickelte die National Security Guidelines for Research Partnerships, die im Juli 2021 eingeführt wurden. Die Richtlinien empfehlen Maßnahmen zur Forschungssicherheit, die Kanadas Forschungsökosystem so offen wie möglich und so sicher wie nötig machen sollen. Sie bieten einen Rahmen, um risikosensible Hintergrundprüfungen (Due Diligence) durchzuführen und die Forschungssicherheit in Bezug auf Forschungspartnerschaften zu verbessern. Sie sind Voraussetzung und fester Bestandteil der Förderprogramme der großen kanadischen Forschungsfördereinrichtungen National Research Council, des National Sciences and Engineering Research Council und des Social Sciences and Humanities Research Council. Die Richtlinien bauen auf den beiden folgenden Initiativen auf und werden durch diese ergänzt.
2. Trainings: Die Initiative „Safeguarding Science“ wurde 2016 von Public Safety Canada (PSC) im Rahmen einer Zusammenarbeit mehrerer Bundesministerien und -behörden ins Leben gerufen. Diese Initiative bietet Workshops für die kanadische Forschungs- und Hochschulgemeinschaft an und gibt einen umfassenden Überblick über Risiken für die Forschungssicherheit und zeigt Strategien zu deren Minderung auf.
3. Informationen: Das Portal „Safeguarding Your Research“ wurde 2020 von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ins Leben gerufen. Es wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Bundesministerien und -behörden entwickelt und von der Forschungsgemeinschaft mitgestaltet. Diese Plattform wird regelmäßig mit neuen Leitfäden und Ressourcen aktualisiert, um der kanadischen Forschungsgemeinschaft nützliche Informationen zum Schutz ihrer Forschung und ihrer Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen, darunter Tools wie: Schulungen, Einweisungsvideos, Checklisten, detaillierte Leitfäden, Fallstudien, u.Ä.
Interessant im weltweiten Vergleich sind in Kanada drei weitere Entwicklungen:
- Die nationalen Richtlinien wurden 2024 durch die „New Policy on Sensitive Technology Research and Affiliations of Concern” ergänzt. Die Regelung ist ein 2-Listen-Ansatz: dieser sieht vor, dass Anträge auf Forschungsförderung bei den föderalen Fördergremien und der Canada Foundation for Innovation nicht mehr bewilligt werden, wenn diese (1) sensible technologische Bereiche (Sensitive Technology Research Areas) betreffen und (2) die Zusammenarbeit mit Forschenden bestimmter, namentlich genannter ausländischer Einrichtungen aus China, Russland und Iran (Named Research Organizations), deren Beteiligung als Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft wurde, vorgesehen ist (enthält aktuell 103 Einrichtungen aus China, Russland, Iran und soll in Kürze um 45 weitere Einrichtungen aus diesen Ländern ergänzt werden).
- Mit Mitteln der kanadischen Bundesregierung wird die Einrichtung von Research Security Offices an Drittmittel starken Universitäten gefördert. Diese sind Service-Einrichtungen – häufig an der Schnittstelle zwischen den Abteilungen Internationales und Forschung angesiedelt, die Forschende bei der Einschätzung von Risiken beraten und unterstützen. Viele der Research Security Officers kommen aus dem Umfeld der Nachrichtendienste (ähnlich wie in Frankreich).
- Der Canadian Security Intelligence Service (CSIS) hat eine eigene Outreach-Abteilung, die regelmäßig mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Organisationen des Privatsektors zusammenarbeitet (bilaterale Gespräche, Bedrohungsbesprechungen und der Austausch von Leitfäden und anderen Informationsquellen).
Australien
Australien gehört mit Kanada und USA zu den ersten Ländern, die umfassende Forschungssicherheitsstrukturen eingeführt haben. In einem kooperativen Ansatz wurden zentrale Richtlinien für und in Zusammenarbeit mit dem australischen Universitätssektor entwickelt. Im August 2019 initiierte die australische Regierung die Gründung der University Foreign Interference Taskforce (UFIT). Sie besteht aus Vertreterinnnen und Vertretern unterschiedlicher Regierungsbehörden und dem Universitätssektor. Die rechtliche Grundlage, die zur Einrichtung der Task Force führte, bildet der 2018 erlassene National Security Foreign Interference Act. UFIT hat Richtlinien (Guidelines to Counter Foreign Interference in the Australian University Sector) entwickelt, die als Handreichung zur Sensibilisierung für Risiken sowie zur Implementierung bedarfsorientierter und abgestimmter Maßnahmen der Forschungssicherheit fungieren. Die Richtlinien sollen Entscheidungsträgerinnen und -träger darin unterstützen, Risiken durch ausländische Einmischung zu bewerten und zu adressieren. Sie bauen auf bestehenden Risikomanagementrichtlinien und Sicherheitspraktiken an australischen Universitäten auf. UFIT versteht sich auch als „community of practice“, die kontinuierlich Erfahrungen und Erkenntnisse austauscht und so gegenseitiges Lernen ermöglichen soll.
Das Department of Industry, Science & Resources hat zudem im November 2021 eine Liste kritischer Technologien von nationalem Interesse veröffentlicht. Kritische Technologien werden darin als „aktuelle und aufkommende Technologien, die das Potenzial haben, die [australischen] nationalen Interessen erheblich zu verbessern oder zu gefährden“ definiert. Dazu gehören z.B. Quantentechnologien, autonome Systeme und Robotik, Künstliche Intelligenz, Biotechnologie u.Ä. Die Liste dient als Orientierung und wird regelmäßig durch die Regierung aktualisiert.
So nutzt z.B. das Australian Research Council (ARC), die größte Forschungsfördereinrichtung für nicht-klinische Forschung, die Critical Technology List zur Überprüfung bzw. Bewertung von Forschungsanträgen. Auch öffentlich zugängliche Informationen wie die Sanktionsregelungen des Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) werden berücksichtigt. Wenn das ARC feststellt, dass ein Risiko bestehen könnte, zieht es nationale Sicherheitsbehörden und/oder externe Anbieter hinzu, um die Bedenken zu prüfen und dazu zu beraten.
Gruppe der Sieben
Auch auf multilateraler Ebene wird Forschungssicherheit als zentrales Politikfeld verstanden – insbesondere im Kontext der G7 und hier mit dem Ziel die Forschungssicherheitsansätze vergleichbar zu machen und so die Forschungskooperationen zwischen den Ländern zu erleichtern. Mit der Einrichtung der Working Group on the Security and Integrity of the Global Research Ecosystem (SIGRE) im Rahmen des G7 Research Compact 2021 wurde ein dauerhafter Austauschmechanismus geschaffen, um Prinzipien, Standards und Best Practices für Forschungssicherheit gemeinsam weiterzuentwickeln und so den Weg zu einer Harmonisierung von Schutzmaßnahmen zu ebnen.
Zu den wichtigsten Umsetzungsinstrumenten zählen die G7 Virtual Academy sowie das begleitende Toolkit, die den Austausch über Ansätze und Richtlinien ermöglichen und seit 2024 auch Staaten außerhalb der G7 offenstehen, sofern diese als Wertepartner akzeptiert werden. Mit Papieren wie den Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity sowie den Best Practices for Secure and Open Research liegt ein gemeinsamer Orientierungsrahmen für Forschungseinrichtungen, Förderorganisationen und Regierungen vor.
Zudem unterstreichen die regelmäßigen Treffen der Wissenschafts- sowie Innen- und Sicherheitsminister*innen der G7 die weltweite politische Relevanz des Themas. Forschungssicherheit wird dabei nicht nur als Schutz vor individueller Gefährdung gesehen, sondern als strategisches Kooperationsfeld – mit dem Ziel, das Vertrauen in internationale Wissenschaftskooperationen zu stärken und kritische Infrastrukturen effektiv zu schützen.