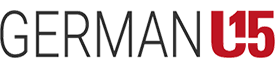Von Bangalore nach Berlin – Warum indische Studierende für Deutschland wichtiger werden und was sie jetzt brauchen
News vom 28.08.2025
Indien stellt inzwischen die größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland – und bringt für Hochschulen und den Arbeitsmarkt enorme Chancen, sagen Felise Fortmann (Konrad-Adenauer-Stiftung) und Jan Wöpking (German U15). Damit diese genutzt werden können, müsse allerdings einiges getan werden.
Die globalen Möglichkeiten für internationale Studierende verändern sich derzeit gravierend. In den USA könnte es zu einem starken Rückgang der Bewerbungszahlen kommen. Und auch andere traditionelle Zielländer wie Großbritannien, Kanada, Australien, aber auch die Niederlande diskutieren über eine Reduktion der Zahl internationaler Studierender oder haben schon entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dies kann zu einer Verlagerung der Studienplatznachfrage innerhalb westlicher Länder führen, von der auch Deutschland profitieren könnte – wenn es gelingt, die Attraktivität für internationale Studierende weiter auszubauen.
Indien rückt aktuell aus gutem Grund in den Fokus deutscher Wissenschafts- und Fachkräftepolitik. Das einwohnerreichste Land der Welt vereint eine junge Bevölkerung, wachsende Wirtschaftskraft und eine geopolitische Schlüssellage. Seine wissenschafts- und technologiepolitischen Ambitionen sind groß. Symbolisch dafür steht die erfolgreiche Landung einer Mondsonde im Jahr 2023. Doch zugleich bleiben die staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung im internationalen Vergleich gering. Junge Talente suchen auch deshalb verstärkt internationale Perspektiven – und finden sie zunehmend in Deutschland.
Das bietet Chancen für beide Seiten. Während der Fachkräftemangel in Deutschland weiter akut bleibt, verfügt Indien über einen Pool motivierter, ambitionierter und gut ausgebildeter junger Menschen. Mit fast 50.000 eingeschriebenen Studierenden stellen Inderinnen und Inder mittlerweile die größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland – und haben damit China als wichtigstes Herkunftsland überholt.
Die meisten indischen Studierenden entscheiden sich für technische und naturwissenschaftliche Fächer. Ihre Zahl hier steigt, während die Nachfrage unter deutschen Studierenden sinkt. Interessant: Indische Studierende wählen gezielt einen Masterstudiengang, 83 Prozent kommen bereits mit Bachelorabschluss nach Deutschland. Die kurze Studiendauer und die Möglichkeit, auf Englisch zu studieren, machen den Master attraktiv.
Hohe Bleibequote. Indische Studierende weisen im Unterschied zu anderen internationalen Gruppen eine höhere Bleibequote auf. Zwei Drittel wollen nach dem Studienabschluss in Deutschland arbeiten. Dies bietet eine Chance gerade für den Bereich hochqualifizierter MINT-Positionen. Schon jetzt liegt das Medianeinkommen indischer Beschäftigter über dem Bundesdurchschnitt.
Was jetzt zu tun ist. Deutschland sollte die wissenschaftliche Kooperation mit Indien weiter ausbauen. Dabei ist wichtig, bei aller Euphorie über den Boom, auch hier einen Ansatz der Diversifizierung zu verfolgen, der eine übergroße Fokussierung und potenzielle Abhängigkeiten von einzelnen Ländern vermeidet und stattdessen auf eine breite und dadurch resiliente Aufstellung internationaler Partnerschaften zielt.
Attraktivität für internationale Studierende weiter erhöhen. Dazu gehört der weitere Ausbau englischsprachiger Studienangebote, auch für den Bachelor, sowie eine zügigere und digitalisierte Visa-Vergabe. Auch bezahlbaren Wohnraum in Hochschulstädten zu finden ist eine Herausforderung, bereits für inländische Studierende, für internationale nochmal mehr. Mehr denn je braucht es zudem ein fortgesetztes politisches Bekenntnis zu einem offenen, talentfreundlichen Deutschland. Wir müssen eine „Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte zeigen“, wie Außenminister Wadephul erst kürzlich gefordert hat.
Noch stärker auf Qualität bei Auswahlprozessen setzen. Zuletzt ist verstärkt der Auswahlprozess für indische Studierende kritisiert worden: er sei intransparent und zu wenig leistungsbezogen. Es gelinge zu selten, die absoluten Top-Studierenden anzuziehen. Um dem zu begegnen, braucht es die Entwicklung leistungsorientierterer Auswahlverfahren.
Übergänge in den Arbeitsmarkt optimieren. Als das zentrale Hindernis beim Übergang indischer Studierender in den Arbeitsmarkt werden oft fehlende Deutschkenntnisse ausgemacht. Denn englischsprachige Studiengänge erleichtern zwar den Einstieg in das Studium, erschweren dann aber ausgerechnet den Übergang in den Arbeitsmarkt. Gerade im für Deutschland typischen Mittelstand sind praxistaugliche Deutschkenntnisse oft unverzichtbar. Frühzeitige Deutschkurse noch im Studium können hier helfen.
Auch der Praxisbezug während des Studiums ist wichtig: Praktika und Werkstudentenstellen erleichtern den Berufseinstieg und stärken zudem die Standortbindung. Karriereberatungs- und Mentoring-Angebote sind bereits oft gut, können aber auch noch weiter ausgebaut werden. Durch eine stärkere Zusammenarbeit von Hochschulen, Kommunen und Wirtschaft können Übergänge besser begleitet und langfristigere Perspektiven eröffnet werden.
Netzwerke stärken. Langfristige Integration gelingt nicht allein über Studium und Arbeit, sondern durch tragfähige Netzwerke. Die indische Diaspora in Deutschland kann hier eine zentrale Rolle spielen. Ihre Erfahrungen und Kontakte sind wertvolle Ressourcen, etwa in Form von Peer-Angeboten, Mentoring oder Alumni-Arbeit. Zugleich sollten Strukturen entstehen, die Talente begleiten und binden. Hochschulen, Unternehmen und Zivilgesellschaft können gemeinsam Plattformen schaffen, um Austausch zu fördern.
Der Boom um Indien und indische Studierende hat gute Gründe – und ist zugleich kein Selbstläufer. Wenn wir jetzt an den richtigen Stellschrauben drehen, kann das immense Potenzial noch besser gehoben werden.
Veröffentlichung im Research.Table, 28. August 2025